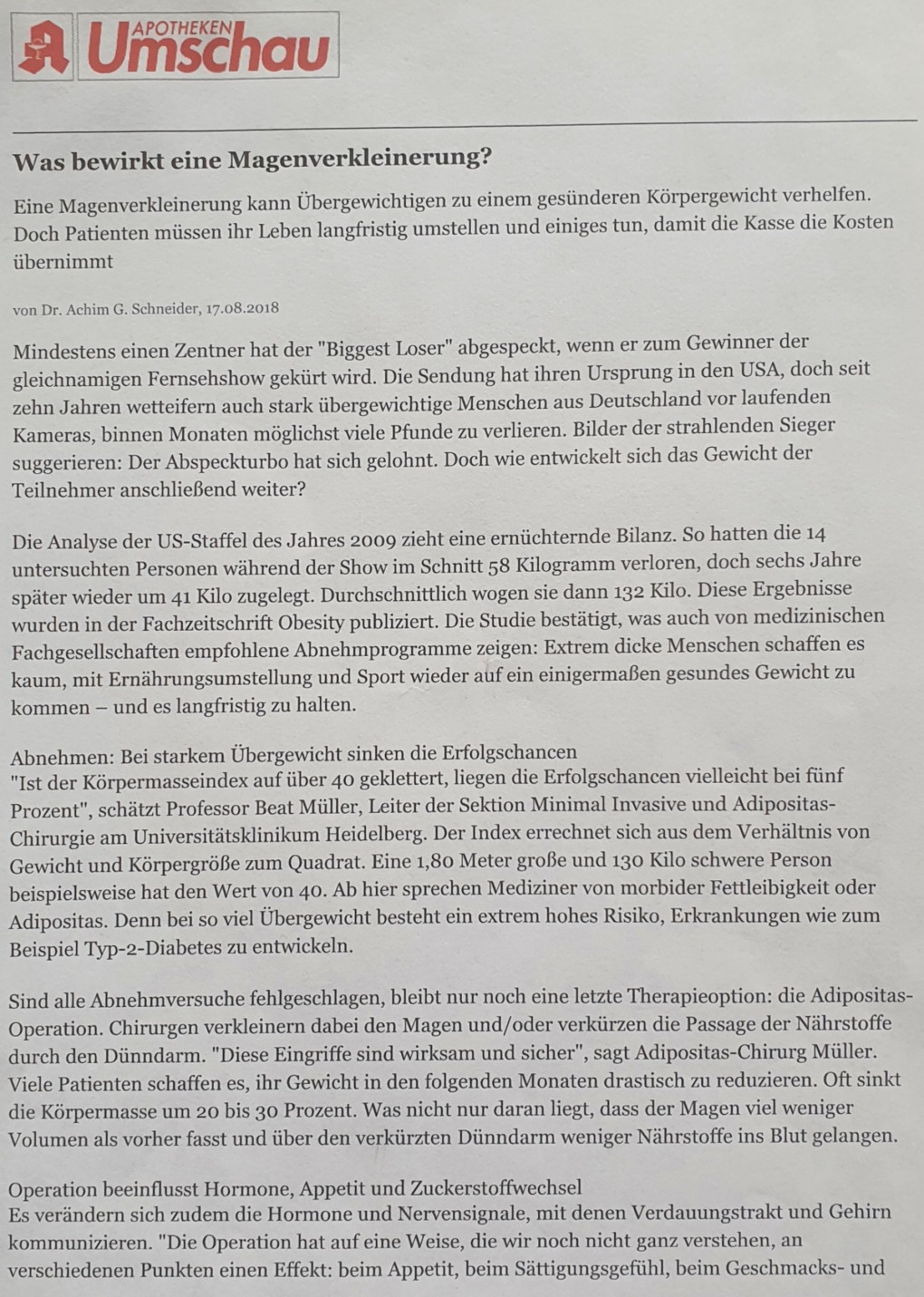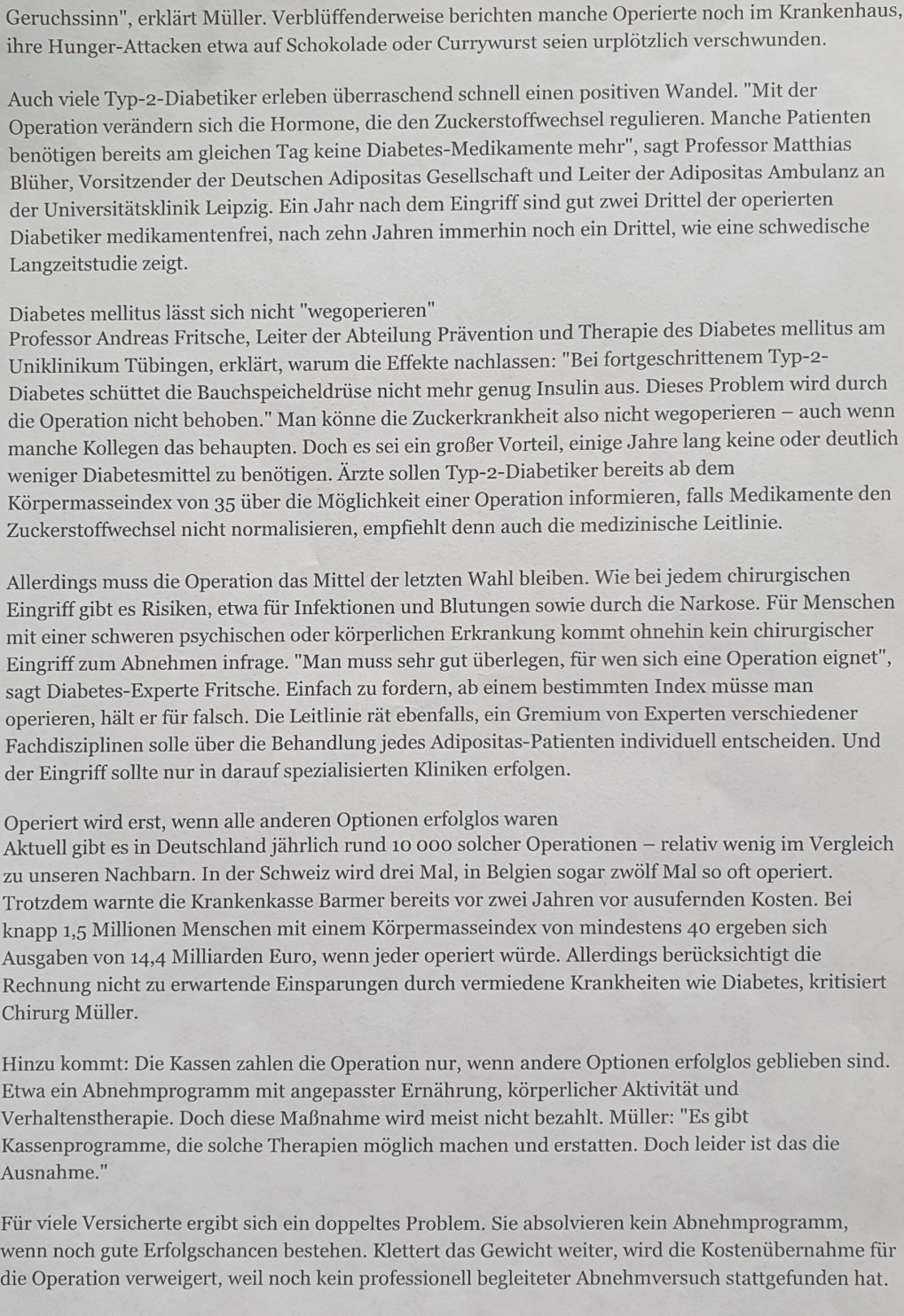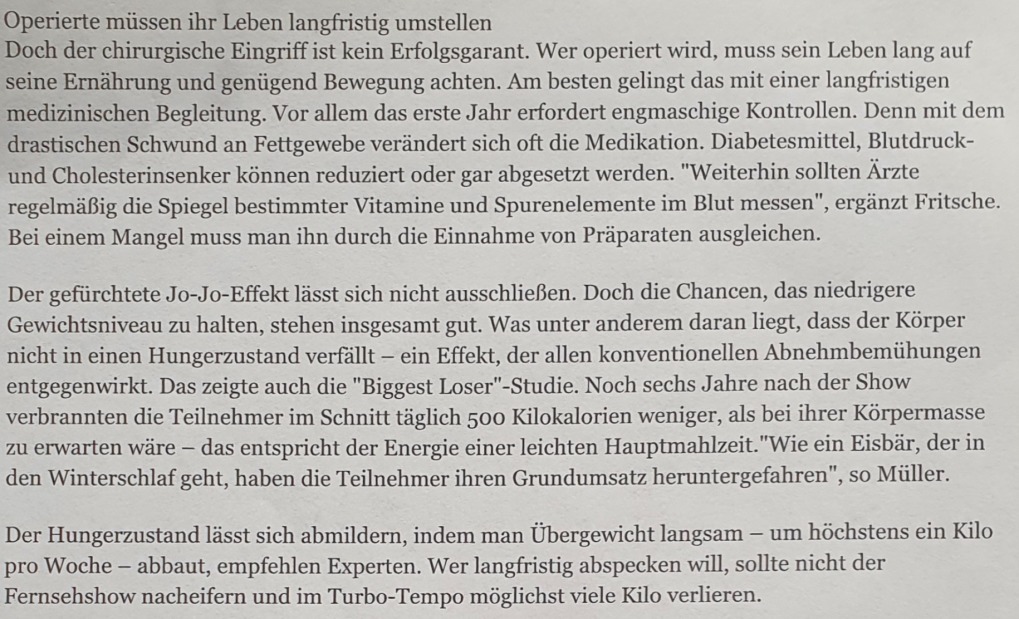Erfahrungsberichte
Mit einer Magen-Operation gegen das Übergewicht – eine Frau und ein Mann erzählen
Für Menschen mit starkem Übergewicht ist eine Magen-Operation oft der letzte Ausweg. Ein Mann und eine Frau erzählen, wie der Eingriff ihr Leben verändert.
Von Constanze Löffler • Wissenschaftliche Prüfung: Dr. Dennis Ballwieser (Arzt) • 31.07.2025
![]() Marcel Brömme und Marlis Lünstäden ließen sich am Magen operieren, um ihr Übergewicht zu reduzieren.
Marcel Brömme und Marlis Lünstäden ließen sich am Magen operieren, um ihr Übergewicht zu reduzieren.
© Bettina Theuerkauf
Marcel Brömme stelllt sich auf die Waage in der Adipositas-Klinik der Schön Klinik Hamburg Eilbek. Noch vor zehn Wochen hatte sie 194 Kilogramm angezeigt. Doch seitdem hat sich etwas in seinem Körper verändert: Adipositas-Chirurg Dr. Johannes Sander hat 90 Prozent von Brömmes Magen entfernt und eine Verbindung zum Dünndarm angelegt – ein sogenannter Magenbypass. Heute, sechs Wochen nach dem Eingriff, bleibt die Waage bei 168 Kilo stehen.
Welche Frage zu Übergewicht haben Sie?
ÜbergewichtTherapienAdipositas-FettsuchtAbnehmen
Adipositas-Spezial: Über Gewicht – wir müssen reden!
Verhältnismäßig wenige Magen-OPs
Bundesweit entscheiden sich pro Jahr mehr als 20.000 Menschen mit Adipositas, ihre Erkrankung chirurgisch behandeln zu lassen. Wenige, wenn man bedenkt, dass gut 13 Millionen mit der Diagnose Adipositas leben. Ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 40 – oder ab 35 bei gewichtsbedingten Begleiterkrankungen wie Diabetes – ist eine OP eine wichtige Therapieoption.
Marcel Brömme, 36, aus Hamburg, bekam Ende April einen Magenbypass. Die OP erfolgte minimalinvasiv. Seit dem Eingriff denkt er nicht mehr ständig ans Essen.
© Bettina Theuerkauf
Vor allem zwei Verfahren werden eingesetzt: Schlauchmagen und Magenbypass. Warum nur wenige den Schritt wagen, hat viele Gründe: mangelnde Aufklärung, bürokratische Hürden, Scham, als adipöser Mensch um Hilfe bitten zu müssen. Vielleicht auch die Sorge vor den Folgen, wenn der Verdauungstrakt chirurgisch umgebaut wird.
Krankheitsbedingte Mangelernährung
Krebspatient Christian verlor während der Chemotherapie 16 Kilo. Hier berichtet er, wie er mit medizinischer Trinknahrung wieder zu Kräften kam.
Tipps für den Alltag – wie Sie dauerhaft abnehmen können
Dass die Adipositas-Chirurgie zur Gewichtsabnahme und darüber hinaus wirkt, ist wissenschaftlich belegt. „Früher dachte man, es geht nur um das kleinere Magenvolumen“, erklärt Sander. „Aber es sind vor allem hormonelle Veränderungen, die den Gewichtsverlust bewirken.“
Weil die Nahrung beim Magenbypass an einem Teil des Dünndarms vorbeigelotst wird, verändert sich die Ausschüttung von Hormonen wie GLP-1 oder Ghrelin – und damit der Appetit. „Viele wachen aus der Narkose auf und merken: Der Heißhunger ist weg“, sagt Sander. Der Schlauchmagen wirkt hormonell etwas schwächer.

So funktioniert ein Magenbypass: Der größte Teil des Magens wird ausgeschaltet, der Restmagen mit dem Dünndarm verbunden (Bypass). Verdauungssäfte gelangen so erst später in den Darm. Nach der OP ist der Verdauungsweg verkürzt, es werden weniger Nährstoffe aufgenommen. Weil unter anderem Bereiche ausgeschaltet wurden, in denen Hungerhormone entstehen, verändert sich das Sättigungsgefühl.
© W&B/Dr. Ulrike Möhle
Weniger Kilos, weniger Begleiterkrankungen
Mit den Kilos schwinden oft auch Beschwerden wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Diabetes. Für viele ist eine Adipositas-Operation der letzte Ausweg, um krankhaftes Übergewicht und die Folgen loszuwerden.
Nach seiner Magen-OP ist Marcel Brömme zufrieden mit dem Ergebnis.
© Bettina Theuerkauf
Marcel Brömme war schon als Kind übergewichtig: „Wenn ich traurig, einsam oder mir langweilig war, habe ich gegessen.“ Ein Kilo Nudeln zum Mittag war normal. Satt sein? Kannte er nicht. Als Football-Profi musste er vor jeder Saison erst einmal 50 bis 60 Kilo abnehmen – und legte sie danach wieder zu.
Erst mit der Unterstützung einer Ernährungsberaterin wurde ihm klar: „Beim Essen läuft bei mir gründlich was schief.“ Mit Corona kam der Tiefpunkt, erzählt Brömme. „Kein Training, keine Kontakte, keine Kontrolle. Nur noch Essen.“
Im Herbst 2024 wagte der IT-Spezialist einen letzten Versuch mit der Abnehmspritze. Sein Appetit wurde weniger. Er verlor zehn Kilo. Aber ihm war häufig übel: eine Nebenwirkung des Medikaments. Brömme setzte es ab. Ihm wurde bewusst: „Ich brauche einen klaren Schnitt.“
Mehr als Hunger: Wer bestimmt, was wir essen?
Vorbereitung auf OP für nachhaltige Ergebnisse
Wer sich operieren lassen will, muss vor dem Eingriff an einem Vorbereitungsprogramm über sechs Monate teilnehmen: eine Voraussetzung, damit die Kassen den Eingriff bezahlen. Weil Brömmes BMI über 50 lag, was mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist, durfte er den Kurs auf drei Monate verkürzen.
Prof. Dr. Yurdagül Zopf, Internistin und Ernährungsmedizinerin am Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport am Uniklinikum Erlangen, betont, wie wichtig eine gründliche Vorbereitung mit einem strukturierten Programm ist. Oft würden dabei – auch mithilfe von Abnehmspritzen – relevante Gewichtsabnahmen erzielt. „Mit professioneller Unterstützung gelingt es den Patientinnen und Patienten dann besser, Ernährung und Lebensstil dauerhaft zu verändern.“
Vor einer vorschnellen Entscheidung für eine Operation warnt Zopf aber. Nebenwirkungen wie Nährstoffmangel, chronische Müdigkeit und Verdauungsprobleme seien möglich. „Viele denken, die OP schützt dauerhaft vor dem Zunehmen – aber das stimmt nicht. Wer wieder zu Hochkalorischem und Süßem greift, nimmt auch mit verkleinertem Magen zu.“
Marlis Lünstäden, 63, aus Hamburg erhielt 2021 einen Schlauchmagen – und für sie auch ein neues Leben: „Früher bekam ich kaum Luft, heute singe ich in einer Castingshow“.
© W&B/Bettina Theuerkauf
60 Kilogramm weniger dank Schlauchmagen
Von negativen Konsequenzen, die ein Eingriff mit sich bringen kann, ließ sich Marlis Lünstäden, 63, nicht abschrecken. Vor ihrer OP im Jahr 2021 spritzte sie sich täglich bis zu 1500 Einheiten Insulin. Andere Menschen mit Diabetes kommen mit einem Bruchteil davon aus.
Mir war klar: Entweder ich ändere mein Leben radikal, oder mich gibt’s bald nicht mehr.
Marlis Lünstäden, verlor 60 Kilogramm durch einen Schlauchmagen
„Ich wog fast 130 Kilo, war schwer herzkrank, bekam schlecht Luft und konnte kaum noch gehen“, erzählt sie. „Mir war klar: Entweder ich ändere mein Leben radikal, oder mich gibt’s bald nicht mehr.“ Über einen Freund erfuhr sie von der Möglichkeit einer OP. Wegen ihrer Vorerkrankungen wurde ihr ein Schlauchmagen vorgeschlagen, da der Eingriff schonender ist als der Bypass. „Als mir die Schwester nach dem Eingriff sagte, ich solle ab jetzt nur noch 24 Einheiten Insulin täglich spritzen, dachte ich, sie hätte sich vertan.“
Die OP ist ein Startschuss. Danach geht die Arbeit erst richtig los.
Marlis Lünstäden, verlor 60 Kilogramm durch einen Schlauchmagen
Aus der schwer kranken Hamburgerin wurde innerhalb weniger Jahre eine lebenslustige Frau. 60 Kilo weniger – dass sie es so weit geschafft hat, sei kein Selbstläufer, betont Lünstäden: „Die OP ist ein Startschuss. Danach geht die Arbeit erst richtig los.“ Sie setzt auf Aqua-Fitness und Radfahren. Ihre Ernährung hat sie umgestellt: „Ich esse fast nur noch Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Fisch.“ Ihr nächstes Ziel: Entfernen der Hautlappen, die nach der Gewichtsabnahme am Bauch herunterhängen.

So funktioniert der Schlauchmagen: Der Magen wird stark verkleinert, sodass nur noch kleine Nahrungsmengen aufgenommen werden können. Nach der OP ist man schneller satt – wegen des verkleinerten Magens und weil hormonproduzierende Magenanteile entfernt sind. Die Aufnahme von Nährstoffen kann eingeschränkt sein.
© W&B/Dr. Ulrike Möhle
Nachsorge entscheidend für nachhaltigen Erfolg
Nicht alle nehmen so erfolgreich ab wie Marlis Lünstäden, sagt Chefarzt Sander. „Bei psychischen Problemen oder Essstörungen ist der Gewichtsverlust oft nicht so gut wie erhofft.“ Entscheidend sei die langfristige Nachsorge – und die Bereitschaft, alte Muster aufzugeben.
In zertifizierten Kliniken werden daher Nachsorgetermine angeboten: anfangs in kürzeren Abständen, später einmal im Jahr. Dabei wird das Gewicht kontrolliert. Blutentnahmen zeigen, welche Vitamine und Spurenelemente ersetzt werden müssen. Marlis Lünstäden nimmt regelmäßig und lebenslang ein spezielles Präparat für etwa 15 bis 20 Euro im Monat ein. Bei Nachsorgeterminen erhalten Betroffene auch psychologische Unterstützung, wenn sie Probleme mit dem neuen Essverhalten haben.
Sechs Wochen nach der OP ist Marcel Brömme noch mitten im Prozess, anders essen zu lernen. Jeden Bissen kaut er zwei Minuten, sonst muss er sich übergeben: „Doch ich denke nicht mehr ständig ans Essen, das ist eine riesige Entlastung.“ Er läuft Strecken zu Fuß, die er früher mit dem E-Roller oder Auto fuhr: „Ich fühle mich wohler, bin psychisch stabiler.“ Der Anfang ist gemacht. Den Rest wird er auch schaffen.

Adipositas-Epidemie in Deutschland – warum Betroffene keine Schuld trifft
Mehr als 13 Millionen Erwachsene in Deutschland sind stark übergewichtig. Oft finden sie nicht oder erst spät die nötige Hilfe. Politik und Industrie sind gefordert, doch es passiert zu wenig, um der Entwicklung entgegenzuwirken.
Von S. Gibis, T. Farin (Redakteur im Medizinressort) • Wissenschaftliche Prüfung: Dr. Dennis Ballwieser (Arzt) • 31.07.2025
Marion Rung-Friebe, 62, war jahrzehntelang übergewichtig – auch wenn man es ihr nach einer OP nicht mehr ansieht. Sie kennt schmerzhafte Sprüche aus eigener Erfahrung.
© W&B/Lena Giovanazzi
Wenn Marion Rung-Friebe ein erstes Gespräch mit Ratsuchenden führt, blickt sie oft in überraschte Gesichter. Etwa wenn sie klar sagt: „Sie sind nicht schuld.“
Welche Frage zu Übergewicht haben Sie?
ÜbergewichtAdipositas-Fettsucht
Nicht schuld daran, dass die Waage von Jahr zu Jahr mehr Kilos zeigt, trotz Crash-Diäten und zahlloser Versuche, gesund und kalorienarm zu essen. Nicht schuld daran, immer wieder gescheitert zu sein. „Sie haben nicht versagt. Sie haben eine chronische Erkrankung“, sagt sie dann. Und nicht selten fließen erst mal Tränen.
Adipositas-Spezial: Über Gewicht – wir müssen reden!
Deutschland in der Adipositas-Epidemie
Marion Rung-Friebe ist zweite Vorsitzende im Adipositas-Verband Deutschland und bietet Selbsthilfegruppen für Menschen mit Adipositas an. So lautet der Fachbegriff, wenn erhöhtes Körpergewicht zur Krankheit wird. Ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 zählt man zu den Betroffenen. Der BMI wird dabei mit einer einfachen Formel berechnet: Gewicht (in Kilogramm) geteilt durch Körpergröße (in Metern)². Bei einer Person von 1,70 Metern wäre dies zum Beispiel ab 87 Kilogramm der Fall.
Kein freier Wille: Wie ungesundes Essen das Gehirn austrickst
Warum Ernährung während einer Krebserkrankung so wichtig ist
Mangelernährung im Verlauf einer Krebserkrankung kann den Therapieerfolg gefährden. Lesen Sie, wie Betroffene von medizinischer Trinknahrung profitieren.
Inzwischen sind in Deutschland knapp 20 Prozent der Erwachsenen an Adipositas erkrankt, etwa doppelt so viele wie noch in den 1990er-Jahren. Fachleute sprechen bereits von einer Epidemie.
Die Kosten für die Gesellschaft sind enorm: Laut Universität Hamburg belaufen sich diese in Deutschland auf etwa 63 Milliarden Euro pro Jahr. Die Berechnung wurde 2016 veröffentlicht, heute wäre die Zahl wohl deutlich höher. Kosten verursacht Adipositas vor allem durch damit einhergehende Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme und Krebs. Zudem leiden viele Betroffene stark unter ihrer Erkrankung, körperlich und seelisch.
Mehr als Hunger: Wer bestimmt, was wir essen?
„Wenn Du nur nicht so dick wärst“
Das Gefühl, falsch zu sein. Das ist das Erste, woran sich Marion Rung-Friebe erinnert, wenn man sie nach ihrer eigenen Geschichte fragt. „Ich war sieben Jahre alt, viel draußen, aktiv, wie andere Kinder. Aber ich war falsch.“ Wenn sie eine Tafel Schokolade geschenkt bekommt, dann mit dem strengen Hinweis: „Iss sie aber nicht sofort!“
Prof. Dr. Katharina Timper ist auf die Behandlung von Menschen mit Adipositas spezialisiert, arbeitet am Klinikum Rechts der Isar der TU München.
© W&B/Frank Bauer
In der Schule nennt man sie schon mal scherzhaft „Antje“, nach dem Walross aus dem NDR-Fernsehen. „Du hast so ein schönes Gesicht“, hört sie oft. „Wenn du nur nicht so dick wärst.“ Im Alter von zwölf Jahren verschreibt der Hausarzt Appetitzügler. Sie führen vor allem zu Übelkeit und einem Nebel im Kopf. „Die will ja gar nicht abnehmen“, sagt der Arzt zu ihren Eltern.
Einstweilen möchte Marion Rung-Friebe sich einfach nicht mehr falsch fühlen. Sie versucht alles: Pillen, Nulldiäten, Pulver-Kuren, Hypnose. „Mein halbes Leben war ich im Hungermodus“, erzählt sie. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Am Ende wiegt sie noch mehr als vorher. Und schämt sich unendlich.
Satt ist sie nie, immerzu kreisen die Gedanken ums Essen: „Nein, du darfst nicht! Nein, tu’s nicht!“ Als sie im Alter von 40 mit mehr als 150 Kilo kaum mehr das Haus verlässt, ist klar: So kann es nicht weitergehen. Sie wendet sich an ein Adipositas-Zentrum – und findet Verständnis. Endlich. „Für mich war es der Start in ein neues Leben“, sagt sie.
Betroffene werden oft stigmatisiert
Die Adipositas-Expertin Prof. Dr. Katharina Timper hat Hunderte Patientinnen und Patienten behandelt, denen es ähnlich erging wie Marion Rung-Friebe. Sie leitet seit Mai 2025 am Klinikum Rechts der Isar der TU München das Institut für klinische Ernährungsmedizin. Auch in ihrer Sprechstunde erzählen die Patientinnen und Patienten oft von ihrem Versagen. „Es ist nicht Ihre Schuld. Sie haben eine chronische Erkrankung“, erklärt sie dann. Und nicht selten fließen auch hier Tränen der Erleichterung.
Denn selbst in ärztlichen Praxen stoßen Menschen mit Adipositas selten auf Verständnis. „Die Verurteilungen sind oft brutal“, sagt Timper, die sich leidenschaftlich gegen diese Stigmatisierung von Menschen einsetzt. Betroffene erleben sie, sobald sie das Haus verlassen. Marion Rung-Friebe erzählt von einem Vorstellungsgespräch. „Ich wollte nur mal sehen, wie so ein dicker Mensch aussieht“, sagte der Mann, der sie eingeladen hatte.
„Es ist unvorstellbar, was die Betroffenen tagtäglich erleben“, sagt Timper. Und das Schlimmste: Irgendwann glauben sie selbst, dass sie Versager sind. Das hat enorme Stressreaktionen zur Folge, kann sogar zu Depressionen führen und verschlimmert so nachweislich die Erkrankung.
Wie Übergewichtige im Gesundheitswesen diskriminiert werden
Ursachen für Adipositas sind vielfältig
Denn Adipositas ist eine Krankheit. „Adipositas entsteht nicht, weil die Betroffenen zu viel essen – die Betroffenen essen zu viel, weil sie an Adipositas erkrankt sind“, sagt Timper. Auch wenn Adipositas nicht als psychische Erkrankung gilt, liegt ihre Ursache vor allem im Gehirn.
Hier sind die komplexen Mechanismen, die unseren Appetit und unser Essverhalten regulieren, verankert. Geraten sie aus dem Gleichgewicht, kommt es zum Überessen – und am Ende oft zu einer Erkrankung, die vor allem durch erhöhte Fettmasse gekennzeichnet ist. Mit vielen negativen Folgen für die Gesundheit.
Kein freier Wille: Wie ungesundes Essen das Gehirn austrickst
Doch wenn die Menschen nicht schuld an ihrer Adipositas sind, wer dann? Wie bei fast jeder Erkrankung gibt es eine Veranlagung, die das Risiko erhöht. „Bei Adipositas ist die genetische Beteiligung vergleichsweise hoch“, sagt Timper. Man schätzt den Anteil auf bis zu 70 Prozent. Belastungen wie Missbrauch in der Kindheit oder Verluste lassen die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Erkrankung kommt, weiter steigen, genauso wie chronischer Stress.
Hinzu kommen Einflüsse, die bereits auf den Embryo einwirken, etwa ein erhöhter Insulinspiegel der Mutter. Hungerkuren fördern die Erkrankung zusätzlich. „Eine Crash-Diät kann dazu führen, dass der Körper seinen Grund-Energieumsatz drastisch senkt“, erklärt Timper. Dieser Energiesparmodus hält lange, vielleicht sogar lebenslang an.
Bei Messungen stellt sie oft einen Grundumsatz von nur 1100 bis 1300 Kilokalorien fest: „Das haben Sie schnell gegessen.“ Normalerweise gilt als Richtwert für Erwachsene ein Grundumsatz von rund 2000 Kilokalorien am Tag.
Adipositas entsteht nicht, weil die Betroffenen zu viel essen – die Betroffenen essen zu viel, weil sie an Adipositas erkrankt sind.
Prof. Dr. Katharina Timper, Adipositas-Expertin
Entscheidend ist, was wir essen
Adipositas-Risiken tragen die Menschen schon viele Jahrtausende in sich. Zur Epidemie konnte die Erkrankung aber erst in unserer modernen westlichen Gesellschaft werden. Schuld ist eine Umwelt, die Fachleute adipogen nennen, also Adipositas-fördernd.
In den Supermarktregalen locken zu Billigstpreisen süße Drinks, flüssige Kalorien, die kaum satt machen. Daneben Schokoriegel, die fast so viel Energie enthalten wie eine durchschnittliche Mahlzeit. Nach einem harten Arbeitstag schiebt man sich schnell eine Pizza in den Ofen. Hinzu kommt unser uraltes evolutionäres Programm, das sagt: „Iss ruhig mehr. Wer weiß, wann die Gelegenheit wieder kommt?“ Doch diese besteht in Zeiten voller Kühlschränke rund um die Uhr.
Mehr wissen und Gürtelrose vorbeugen
Für Menschen mit einer chronischen Krankheit ist es besonders wichtig, über ihr Gürtelrose-Risiko Bescheid zu wissen. Wieso, erfahren Sie hier.
Wie die Gesellschaft Übergewichtige herabwürdigt und ausgrenzt
Entscheidend ist aber nicht nur das pausenlose Angebot an Nahrung. Es kommt auch darauf an, was wir essen. Experimente am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln zeigen, dass schon ein kleiner Snack zusätzlich pro Tag unser Gehirn verändern kann – wenn dieser viel Fett und Zucker enthält. Ein Schokopudding, den schlanke Testpersonen zwei Monate lang täglich aßen, reichte. Die Folge: Das Gehirn will mehr davon, indem es klar das Signal gibt, ungesunde Snacks zu bevorzugen. Die Anweisung kommt vor allem aus dem Belohnungszentrum, das bei der Entstehung von Sucht eine große Rolle spielt.
Mein halbes Leben war ich im Hungermodus.
Marion Rung-Friebe
Lust auf Süßes ähnlich wie bei einer Abhängigkeit
Gibt es also eine Sucht nach bestimmten Nahrungsmitteln? Der renommierte US-amerikanische Autor Prof. Dr. Robert Lustig ist davon überzeugt. Er ist Experte für den Stoffwechsel des Nervensystems. Für ihn ist die unbezwingbare Lust auf Süßes nichts anderes als das Verlangen bei einer Abhängigkeit, etwa von Alkohol oder Nikotin.
Der Hauptschuldige in Sachen Adipositas-Epidemie: für Lustig eindeutig der Zucker – denn der steckt auch in fast allen hoch verarbeiteten Lebensmitteln, in Ketchup, Fertigsoßen oder Salami. Vom Zucker steigt der Insulinspiegel im Blut, das Hormon führt dazu, dass der Körper die Energie als Fett speichert. Ein wichtiges Signal aus den Fettzellen kommt gar nicht mehr an: genug gegessen! „Wenn man den Insulinspiegel erhöht, isst jeder mehr“, betont Lustig.
Besonders kritisch ist laut Lustig der Konsum von Fruktose, dem Fruchtzucker, der auch im Haushaltszucker steckt. Der Körper macht damit etwas Ähnliches wie mit Alkohol. So fördert Fruktose auch eine Erkrankung, die bei häufigem Alkoholkonsum droht: die Fettleber. Sie steht im direkten Zusammenhang mit erhöhtem Insulinspiegel und Typ-2-Diabetes, einer der häufigsten Folgen von Adipositas.
Gehirn kommt vom Zuckertrip schwer runter
Muss die Botschaft daher lauten: Esst weniger Zucker – und ihr werdet schlank? So einfach ist das nicht. Denn: Ist das Gehirn auf viel Zucker geeicht, kommt es von diesem Trip nur schwer wieder runter. Und die Eichung beginnt meist sehr früh.
Die Mannheimer Gesundheitspsychologin Prof. Dr. Jutta Mata erinnert sich gut, als ihrem Kind kurz nach der Geburt ein Tropfen Blut aus der Ferse abgenommen werden sollte. Um es zu beruhigen, bekam es einen Tropfen Zuckerwasser auf die Zunge. „Der allererste Tag im Leben. Und los geht’s mit Zucker als Belohnung“, sagt sie. So geht es meist weiter.
In Kita und Schule sind die leckeren Sachen oft süß und fetthaltig. Hinzu kommt eine Lebensmittelindustrie, die ihre Produkte bewusst so gestaltet, dass das Gehirn darauf anspringt. „Hier gibt es Fachleute, deren Aufgabe es ist, der Schokolade den perfekten Schmelz zu geben, sodass sie unsere Belohnungszentren zum Explodieren bringt“, sagt Mata. Dann zu sagen, es sei allein die Schuld jedes Einzelnen, seine Esslust nicht zügeln zu können – „das ist schlicht absurd“.
Magen-OP gegen Übergewicht – eine Frau und ein Mann erzählen
Ernährungsberatung als wichtiger Teil der Therapie
Dass der Staat vor allem, um die Kinder zu schützen, regulierend eingreifen muss, hält sie für unbedingt nötig. Eine Zuckersteuer, ein Werbeverbot für ungesunde Kinderlebensmittel wären in ihren Augen gute Anfänge. „Die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen klar, dass das sinnvoll wäre“, sagt Mata. „Es muss etwas passieren, das unsere Kinder schützt“, betont auch Rung-Friebe. „Das ist keine Flutwelle, die auf uns zurollt, das ist ein Tsunami.“
Für die mehr als 13 Millionen Menschen, die in Deutschland bereits mit Adipositas leben, kommt ein Eingreifen zu spät. Doch auch wenn ihre Erkrankung unheilbar ist, sie lässt sich oft erfolgreich behandeln.
Programme, in denen die Patientinnen und Patienten unter fachlicher Begleitung an Gewicht verlieren, haben sich als nur mäßig erfolgreich erwiesen. „Die allermeisten nehmen deutlich an Gewicht ab“, sagt Timper. Fällt die Betreuung weg, nehmen viele früher oder später aber wieder zu.
Nachhaltiger wirkt die Adipositas-Chirurgie, durch die auch der Stoffwechsel dauerhaft verändert wird. Sehr gute Erfolge sieht Timper seit einigen Jahren durch den Einsatz der neuen Adipositas-Medikamente. „Sie setzen dort an, wo Adipositas entsteht: im Gehirn“, sagt sie. Doch sind auch sie keine Wunderwaffe. Zentraler Teil der Behandlung sollten unbedingt eine Ernährungsberatung sowie eine angeleitete Bewegungstherapie sein.
Tipps für den Alltag – wie Sie dauerhaft abnehmen können
Bessere Lebensqualität nach OP
Bei Marion Rung-Friebe war klar: Ohne eine OP hatte sie keine Chance, dauerhaft an Gewicht zu verlieren. Nach hartem Kampf mit der Krankenkasse erhielt sie die Therapie, die sie brauchte: eine Verkleinerung des Magens. „Schon am nächsten Tag ging es mir besser“, erzählt sie. Die Gedanken an Essen – weg.
„Zwei Teelöffel Joghurt und ich war satt. Und glücklich.“ Nicht bei allen schlägt eine OP so gut an. Bei Marion Rung-Friebe hatte sich nach gut einem Jahr das Gewicht mehr als halbiert. Sie fühlte eine nie gekannte Freiheit: „Einen Flug zu buchen, ohne zu überlegen: Pass ich in den Sitz? Eine Treppe hochgehen zu können, im Restaurant zu essen ohne diese ständigen Blicke.“
Hier gibt es Fachleute, deren Aufgabe es ist, der Schokolade den perfekten Schmelz zu geben, sodass sie unsere Belohnungszentren zum Explodieren bringt
Prof. Dr. Jutta Mata, Gesundheitspsychologin
Heute wiegt Marion Rung-Friebe 61 Kilo. „Man sieht es mir nicht an. Aber ich habe noch immer Adipositas“, sagt sie. Durch ihre Verbandsarbeit unterstützt sie Betroffene, ihren eigenen Weg zu finden, mit ihrer Erkrankung gut zu leben. „Es geht nicht darum, möglichst viel abzunehmen. Es geht darum, wie gesund du wirst und wie viel Teilhabe du am Leben bekommst“, sagt sie.
Die Krankheit führt oft in die Einsamkeit. Doch müsse man nicht alleine bleiben. Sie rät: „Holt euch Hilfe!“
Welt-Adipositas-Tag"Übergewicht und psychische Probleme meist Hand in Hand"
Stand: tagesschau 04.03.2024 15:52 Uhr
Nicht nur ein bisschen zu dick, sondern stark übergewichtig. Weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen adipös. Betroffenen hilft oft nur eine radikale Lebensumstellung.
Von Sandra Biegger, SWR
Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Nina Keller aus der kleinen Gemeinde Hamm am Rhein hält nichts in ihren eigenen vier Wänden. Die 44-Jährige dreht zügig ihre Runden im Grünen. Und das, obwohl sie frisch operiert ist. Vor nicht einmal zwei Wochen wurden der Physiotherapeutin und Intensivkrankenschwester bei einer Bauchdeckenstraffung zwei Kilo überschüssige Haut entfernt. Eines der letzten Überbleibsel aus ihrem früheren Leben.
Spätestens seitdem erscheint es nahezu undenkbar, dass die 1,69 Meter große, quirlige Frau mit dem bunten Tuch im Haar bis vor wenigen Jahren teilweise noch 163 Kilo gewogen hat. Ihr Body-Mass-Index (BMI) lag da bei 57. Ab einem BMI von 25 gilt man als übergewichtig. Mittlerweile wiegt Nina Keller nicht einmal mehr halb so viel wie früher. Sie sagt: "Neues Leben, neue Chance!" Mit den verlorenen Kilos kehrte auch die Lebensfreude zurück.
Teufelskreis aus Essen und Frust
Nina Keller war nicht immer dick. Als Kind und Jugendliche macht sie Leistungssport - Leichtathletik, Fünf- und Siebenkampf. Sie heiratet früh, bekommt zwei Kinder. Anfangs ist alles gut. Nach einigen Schicksalsschlägen, Stress im Job und im Privatleben verliert die zweifache Mutter jedoch immer mehr die Kontrolle über ihr Leben. Essen wird ihr Seelentröster und ihre Geisel. Sie bekommt Bluthochdruck, sich zu bewegen wird zunehmend zur Qual.
Immer häufiger bekommt sie ungefragt Ratschläge zu ihrem Gewicht. Sie mögen vielleicht gut gemeint sein, verletzen sie jedoch meistens. Nicht zuletzt aufgrund ihrer medizinischen Ausbildung weiß die zweifache Mutter selbst bestens, was sie mit ihrer Fettleibigkeit dem Körper antut. Sie bekommt dramatischen Bluthochdruck, die Sorge vor Diabetes, Herzproblemen und anderen Folgeerkrankungen rauben ihr oft den Schlaf.
Die Kämpferin in ihr sagt den Kilos den Kampf an. Mal nimmt sie in Eigenregie 20 Kilogramm ab, dann wieder 30 zu. Ein Teufelskreis aus guten Vorsätzen, Frust, Selbsthass noch mehr essen beginnt. Als sie wegen einer schweren Krankheit notoperiert werden muss und Angst hat zu sterben, schließt sie mit sich selbst einen Pakt: "Wenn ich das hier überlebe, gehe ich meine Adipositas konsequent an." Rückblickend sagt sie: Es war allerhöchste Zeit, letztlich sei sie nicht nur körperlich krank gewesen, sondern auch depressiv.
Magenverkleinerung, Ernährungsumstellung - Sport: Wer Nina Keller heute sieht, kann sich kaum vorstellen, dass sie mal 163 Kilogramm wog.
Adipositas und Depressionen
"Nina Keller ist kein Einzelfall", sagt Johannes Oepen vom Adipositasnetzwerk Rheinland-Pfalz. "Krankhaftes Übergewicht und psychische Probleme gehen meist Hand in Hand." Patientinnen und Patienten würden häufig mehr essen, weil sie depressiv sind. Die mit der Fettleibigkeit verbundenen Kränkungen und der Rückzug in sich selbst wiederum würden die Depressionen noch verstärken.
Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist überzeugt: "Adipositas könnte die teuerste Krankheit werden, die wir haben." Denn: Neben den seelischen sind auch die möglichen körperlichen Folgeerkrankungen enorm.
Hohes Übergewicht kann sich in vielerlei Hinsicht negativ auf den Körper auswirken. Atemnot, Schlafapnoe, Gelenkschmerzen, hoher Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt, Hirnschlag, Fettleber, entzündete Organe und ein höheres Krebsrisiko sind nur einige der Folgen, vor denen Medizinerinnen und Mediziner warnen. Mediziner Oepen sagt, besonders tückisch sei, dass man vieles davon erst spät mitbekomme: "Wenn sich beispielsweise die Leber verändert, dann merken sie das erst mal nicht."
Nicht faul und dumm
Fachleute sagen: Adipositas ist keine Folge von Willensschwäche, sondern eine ernstzunehmende, chronische Krankheit. Betroffenen dürfe nicht unterstellt werden, faul und dumm zu sein. Adipositas müsse ernsthaft behandelt werden. Verena Ursprung vom Adipositas-Zentrum der Klinik Worms betont, extremes Übergewicht bekomme man häufig nicht ausschließlich mit Bewegung und Ernährungsumstellung in den Griff.
Sie und ihre Kollegen arbeiten eng mit dem städtischen Gesundheitsnetz WOGE zusammen. Bei der Behandlung von Adipositas-Patientinnen und -Patienten setzen sie auf ein multimodales Konzept. Dazu gehören Ernährungsberatung, Sportprogramme, Selbsthilfegruppen, psychologische Betreuung, Beratung über medikamentöse Behandlungsmethoden und - als letzter Ausweg - Operationen. Nach Angaben von Medizinerin Ursprung sind diese sinnvoll ab einem BMI von 35 in Verbindung mit Nebenerkrankungen oder einem BMI ab 40.
Die Medizinerin erklärt, wenn der Magen verkleinert und der Verdauungsweg verkürzt werden, führe das nicht nur dazu, dass der Körper weniger Nahrung aufnimmt: "Weil hormonelle Faktoren über den Darm und das Gehirn das Hunger- und das Appetitgefühl steuern, ändert sich nach einem chirurgischen Eingriff natürlich auch auf der Ebene des Gehirns etwas." Nach einer Operation verringere sich darüber hinaus nicht nur das Gewicht. Weil sich auch der Stoffwechsel verändere, bilde sich beispielsweise Zuckerkrankheit zurück.
Operation kein Allheilmittel
Klar ist jedoch auch: Eine Operation ist ein großer Eingriff, der zahlreiche Nebenwirkungen haben kann. Außerdem müssen Operierte ihr Leben lang Nährstoffe zuführen: Dadurch, dass sie weniger essen, nehmen sie auch nicht mehr genügend Vitamine und Mineralstoffe auf. Eine dauerhafte Nachsorge ist unerlässlich.
Ohnehin bleibe man sein ganzes Leben adipös, sagt Marion Rung-Friebe vom Adipositas Verband Deutschland. Auch sie hat sich operieren lassen. Ein Eingriff könne eine Möglichkeit sein, unter sein vorheriges krankhaft übergewichtiges Leben einen Schlussstrich zu ziehen, quasi neu anzufangen. Dauerhaft gehe es ohne Sport und Psychotherapien aber nicht, betont Rung-Friebe. Nur so erreiche man dauerhaft ein Wohl- und Sättigungsgefühl, lebe nicht wie während einer Diät ständig im Hungermodus.
Adipositas-Patientin Nina Keller hat sich den Magen verkleinern lassen, ihre Ernährung umgestellt, macht wieder Sport. Wer sie heute sieht, kann sich kaum vorstellen, dass sie mal 163 Kilogramm wog. Die 44-Jährige kann sich hingegen noch sehr gut erinnern, wie wertlos, einsam und hässlich sie sich lange Zeit gefühlt hat. Und wie weh abschätzige Blicke und kritische Bemerkungen tun können. Ihr Appel an andere Betroffene: "Geht raus aus eurem Schneckenhaus, sucht euch Hilfe, ihr seid nicht allein. Wir sind viele!"
Internationale StudieFettzellen "erinnern" sich an Übergewicht
Stand: tagesschau 19.11.2024 19:18 Uhr
Den Jojo-Effekt kennen viele: Man nimmt ab, doch nach und nach steigt das Gewicht wieder an. Der Grund ist nicht unbedingt fehlende Disziplin: Eine neue Studie zeigt, dass sich die Fettzellen an das Übergewicht "erinnern".
Von Veronika Simon, SWR
Etwa die Hälfte der Deutschen ist laut Robert Koch-Institut übergewichtig - fast jeder Fünfte hat Adipositas, also starkes Übergewicht mit einem Body-Mass-Index über 30.
Das zusätzliche Gewicht loszuwerden, sei dabei in vielen Fällen nicht das größte Problem, erklärt Tobias Meile. Er leitet das Adipositas-Zentrum im Klinikum Stuttgart. "Natürlich ist es mühsam, zwanzig Kilo abzunehmen. Aber die größte Herausforderung ist es, das niedrigere Gewicht langfristig zu halten."
Der Jojo-Effekt sei nicht umsonst berühmt-berüchtigt. Die meisten Menschen, die sich in der Adipositas-Ambulanz vorstellten, hätten bereits viele Diäten hinter sich, die alle keinen langfristigen Erfolg mit sich gebracht haben. Doch bisher habe man diesen Effekt nicht genau erklären können.
Jojo-Effekt liegt nicht an mangelnder Willenskraft
"Es gibt eine gewisse Stigmatisierung von Menschen die übergewichtig sind, abnehmen und es dann nicht schaffen, das Gewicht zu halten", erklärt auch Ferdinand von Meyenn. Er forscht an der ETH Zürich an Fettzellen.
Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam hat er jetzt in der Fachzeitschrift Nature eine Studie veröffentlicht: Sie konnten zeigen, dass es offenbar molekulare Mechanismen gibt, die den Körper dazu bringen, gegen den Gewichtsverlust anzukämpfen.
Dafür haben die Forschenden Fettgewebe von Menschen analysiert, deren Adipositas mit einer Magen-Operation behandelt wurde. Die Proben wurden ihnen vor und nach der massiven Gewichtsabnahme entnommen. Das Ergebnis: Auch zwei Jahre nach der Operation "erinnerten" sich die Fettzellen noch an das Übergewicht - durch unterschiedliche Genaktivitäten.
Zellen werden dauerhaft umprogrammiert
Denn an sich haben alle Zellen die gleichen Gene, aber es werden nicht immer dieselben genutzt. Zum Beispiel als Anpassung an ihre Umwelt markiert eine Zelle, welche Gene abgelesen werden.
Die Konsequenz: Die Zellen haben andere Eigenschaften. Das kann dazu führen, dass Fettzellen bei Übergewichtigen zum Beispiel größer werden oder schneller Energie aufnehmen. Und diese Eigenschaften behielten die Zellen auch nach einer Gewichtsabnahme. "Dabei muss man bedenken, dass Fettzellen sehr langlebig sind", sagt von Meyenn. "Die sind zum Teil bis zu zehn Jahre im menschlichen Körper. Sie können Veränderungen also wirklich langfristig speichern."
Das gleiche Ergebnis erhielten die Forschenden mit Versuchen an übergewichtigen Mäusen. Deren Fettzellen hatten auch veränderte Markierungen im Erbgut, auch bei ihnen wurden veränderte Genmuster abgelesen. Das Ergebnis: Auch Monate nach einer Abnahme nahmen die Zellen noch mehr Zucker und Fett auf als Zellen von Mäusen, die immer normalgewichtig waren. Die ehemals dicken Mäuse nahmen schneller zu - der Jojo-Effekt.
"Müssen viel früher in der Therapie anfangen"
Mit dieser Studie sei noch nicht bewiesen, dass die entdeckten genetischen Markierungen wirklich der Grund für den Jojo-Effekt sind, das sagen auch die Studienautorinnen und Studienautoren.
Doch für Meile vom Adipositas-Zentrum in Stuttgart ist die jetzt vorgestellte Studie sehr interessant. "Das erleuchtet manche Dinge, bei denen wir uns schon lange fragen, warum das so ist." Für ihn unterstreichen diese Ergebnisse, wie wichtig Prävention bereits im Kindes- und Jugendalter ist: "Wir müssen viel früher in der Therapie anfangen. Wenn man eine Diät oder eine drastische Gewichtsreduktion braucht, ist es eigentlich schon zu spät, dann sind die Zellen bereits auf Übergewicht programmiert." Viel sinnvoller sei es, die Gewichtszunahme an einem Zeitpunkt zu stoppen, an dem man nur nicht weiter zunehmen muss.
Weitere Forschung nötig
Von einer gezielten Behandlung, die die jetzt entdeckten, genetischen Markierungen rückgängig machen könnte, sei man noch weit entfernt. Da sind sich die Fachleute einig.
Die Ergebnisse der jetzt vorgestellten Studie könnten aber für weitere Forschung genutzt werden, so Studienautor von Meyenn. Denn auch aktuelle Medikamente wie die sogenannte Abnehmspritze müsse man dauerhaft verwenden, wenn man nicht wieder zunehmen will. "Hier ist noch viel Forschung gefragt, um festzustellen, ob man diese Signaturen diagnostisch nutzen könnte oder welche Medikamente, welche Interventionen sie vielleicht löschen könnten, wie Sport oder eine bestimmte Ernährung."

Adipositas
Über Gewicht – wir müssen reden!
Normalerweise sprechen wir nicht miteinander über unser Gewicht. Es wird stattdessen übereinander gesprochen, gelästert, geurteilt. Das wollen wir ändern.
Adipositas ist mit über 13 Millionen betroffenen Erwachsenen in Deutschland eine Volkskrankheit.
Mehr wissen und Gürtelrose vorbeugen
Für Menschen mit einer chronischen Krankheit ist es besonders wichtig, über ihr Gürtelrose-Risiko Bescheid zu wissen. Wieso, erfahren Sie hier.
Die Mehrheit der Deutschen ist mittlerweile übergewichtig mit gesundheitlichen Folgen. Wer zu viel isst, nimmt zu, wer seine Grenzen kennt, bleibt schlank. Und wenn Dicke disziplinierter wären, dann müssten sie nicht dick sein. Wer dick ist, ist selbst schuld und entscheidet sich täglich aufs Neue, dick zu bleiben. – Kleines Problem: stimmt halt nicht.
Forscherinnen und Forscher wissen schon sehr lange, dass Übergewichtige in einer das Dicksein fördernden Umgebung kaum Chancen haben, dauerhaft abzunehmen. Und dass es keine freie Willensentscheidung ist, dick zu bleiben. Die Wissenschaft macht auch eine Reihe von Vorschlägen, was wir gesellschaftlich ändern müssten. Die aber sind politisch bisher nicht durchzusetzen gewesen. Wir laden Sie ein. Diskutieren Sie mit uns darüber, was wir tun sollten und können. Ich bin einer der Millionen übergewichtigen Deutschen. Also mache ich den Anfang. Sie lernen mich in unseren Artikeln, den begleitenden Videos und Podcasts kennen, wenn Sie wollen. Schreiben Sie mir von Ihren Erfahrungen an d.ballwieser@a-u.de.
Mehr als Hunger: Wer bestimmt, was wir essen?
Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.
Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?
Wussten Sie, dass …
… jeder fünfte Erwachsene stark übergewichtig ist?
Adipositas ist mit über 13 Millionen betroffenen Erwachsenen in Deutschland mittlerweile eine Volkskrankheit. Mit ihr steigen die Risiken für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes oder psychische Erkrankungen – und für einen verfrühten Tod. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnt, dringend in die Vorbeugung und Behandlung zu investieren. Doch es wird zu wenig dafür getan. Lesen Sie dazu mehr in diesem Interview.
… Kinder gesundes Essen lernen können?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat untersucht, wie viel ein gesundes Mittagessen nach DGE-Standards kostet, das in Schule oder Kita gekocht wird: 5,40 Euro pro Kind. Ohne die Standards betragen die Kosten 5,36 Euro – nur 4 Cent weniger. Welche Länder es besser machen als wir, lesen Sie hier.
… Übergewicht Betroffene häufig einsam macht?
Wie aus den Ergebnissen der Leipziger LIFE Adult-Studie mit 8350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hervorgeht, sind 20 von 100 Erwachsenen mit Adipositas sozial isoliert. In der Vergleichsgruppe ohne Adipositas betraf das nur etwa 11 von 100. Unsere Autorin beschreibt ihren Weg aus der Unsichtbarkeit.
… fast jedes dritte Kind zwischen sieben und neun Jahren zu dick ist?
Die WHO sieht das Problem in Europa als gravierend an. Die Weichen für Übergewicht und Adipositas werden früh gestellt. Hersteller von zucker-, fett- und salzhaltigen Lebensmitteln tragen dabei Mitverantwortung. Mehr zum Thema Kindheit und Adipositas lesen Sie hier.
… wir umgeben sind von Werbung für Ungesundes, die uns dick macht?
Wie eine britische Forschungsgruppe auf dem diesjährigen Europäischen Adipositas-Kongress berichtet, essen Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren unter dem Einfluss von Werbung für zucker-, fett- und salzreiche Lebensmittel wesentlich mehr: Sie konsumieren demnach mehr Snacks, größere Mittagessensportionen und insgesamt mehr Lebensmittel. Das summiert sich nach dieser Analyse auf 131 Kilokalorien zusätzlich im Vergleich zu jungen Menschen ohne diesen Einfluss. Schätzungen zufolge sehen Kinder pro Tag 15 solcher verführerischen Werbespots. Mehr über die Macht der Lebensmittelindustrie lesen Sie hier.
… gut gemeinte Ratschläge Betroffenen oft nicht helfen?
„Iss weniger“ und „Mach mehr Sport“ bekommen Menschen mit Adipositas oft zu hören. Doch so einfach ist Abnehmen nicht. Eine echte Option sind Semaglutid oder Tirzepatid, die Wirkstoffe in Abnehmspritzen. Allein aus Kostengründen sind diese aber nicht für alle Betroffenen verfügbar. Daher ist es gut, andere Therapiemaßnahmen zu kennen und über deren Vor- und Nachteile Bescheid zu wissen, zum Beispiel über das Disease-Management-Programm Adipositas, das 2024 beschlossen wurde. Wie man mit Veränderungen im Alltag Gewicht verlieren kann, lesen Sie hier.
… Menschen mit Übergewicht nicht schuld sind?
Adipositas ist eine chronische Krankheit, die durch vielfältige Ursachen beeinflusst und durch eine an Reizen reiche Umwelt gefördert wird. Einen großen Anteil daran, ob man zu starkem Übergewicht neigt, haben auch unsere Gene. Warum ist die Gesellschaft so fettfeindlich?
… immer noch viel Unwissenheit herrscht?
Einem Bericht des Max Rubner-Instituts aus dem Jahr 2021 zufolge haben die Menschen hierzulande eine geringe Ernährungskompetenz. Das heißt, ihnen fehlen Kenntnisse und Fähigkeiten, um gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Warum wir oft unbewusst zu viel essen, erfahren Sie hier.
… Adipositas 63 Millliarden Euro kostet?
– und zwar im Jahr alleine in Deutschland. Die Summe ergibt sich aus Behandlungskosten und den indirekten Folgen von Übergewicht. Die Zahl nannte eine Forschergruppe der Uni Hamburg im Jahr 2016. Mehr dazu hier.
Übergewicht: Ursachen, Folgen und gesellschaftliche Verantwortung | Apotheken Umschau